Kolumnen
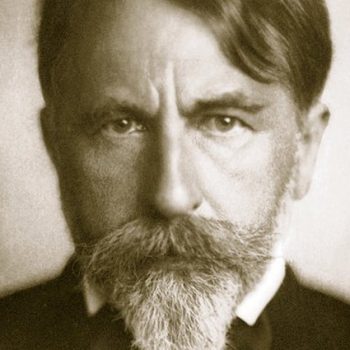
„Running sushis“ der Liebe – 07.01.2017
Anatol, Schnitzlers Beziehungs-Junkie, der hatte noch Stil beim Gemeinsein. Sein zu entsorgendes G’spusi lud er ins Séparée zum Abschiedssouper ein – zu Champagner und Filets aux truffes. Und hoffte inbrünstig, dass die zukünftige Ex-Annie nicht in Schluchzen ausbrechen würde: „Ich kann das Weinen nicht vertragen – ich verlieb’ mich am Ende von neuem in sie, wenn sie weint.“ Rund 120 Jahre später haben die digitalen Technologien die Partnerselektion zu einer Art „running sushi“-Veranstaltung verwandelt. Vom Spähposten seines Laptops kann man in Häschenpantoffeln beobachten, wie ständig neue Personen-Angebote auf den Fließbändern von „Tinder“, „Facebook“ oder sonstigen Menschenfischerportalen eintrudeln. Diese Form eines neuen emotionalen Kapitalismus beschert uns frostige Begleiterscheinungen: „Ghosting“ zum Beispiel. So bezeichnen Soziologen jenes neue Phänomen, dass amouröser Frischfang nach zwei, drei Dates kommentarlos im Nirwana der Unerreichbarkeit verschwindet. Und wahrscheinlich längst wieder sondierend am Fließband der Liebe steht. Bedauerlicherweise tendieren besonders Frauen dazu, ein solches Fluchtverhalten dann auch gleich persönlich zu nehmen. Männer sind da prinzipiell viel pragmatischer. Sie tun sich ja bekanntlich schon schwer damit, über ihre Gefühle zu reden. Noch mühsamer erscheint es ihnen, jene, die sie nicht mehr haben, zu bemurmeln. Z hängt auf meinem Sofa, sie betrauert gerade einen solchen Tinder-Geist. Ich fische ihr im Netz ein Gedicht: „Laß mein Aug den Abschied sagen, den mein Mund nicht nehmen kann. Schwer, wie schwer ist er zu tragen. Und ich bin doch sonst ein Mann.“ – „Wer hat diesen Schrott geschrieben?“ – „Goethe hieß die Kanaille.“ – „Auch völlig überschätzt, der Typ“, antwortete sie, „so ein Weichei. Sein Werther hatte sich wenigstens noch erschossen. Das nenne ich Manieren.“